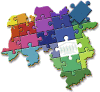|
14.
September 2004
Sachsen als Küche des Ottonischen Reiches
Vortrag von Prof. Dr. Ernst Schubert
Sachsen, so äußerte vor 1000 Jahren Kaiser Heinrich
II., sei gleichsam ein paradiesischer Pflanzengarten, in dem
gleichermaßen Sicherheit („securitas") und Überfluss („ubertas")
herrschten. Dem scheint zu entsprechen, dass drei Generationen später
Sachsen als Küche des Reiches bezeichnet wurde. Unzweifelhaft lag hier
die Basis für das von 919 bis 1024 herrschende Haus der oft sogenannten
„Sachsenkaiser". Welche Wirklichkeit aber stand hinter dem Lobpreis
durch Kaiser Heinrich? Und: Konnte es nicht zweischneidig sein, wenn
Sachsen als Küche des Reiches bezeichnet, der Stamm zum Dienst für das
Königtum verpflichtet wurde? Was zur einfachen Beschreibung einlädt,
führt tatsächlich in ein dornenreiches Feld komplizierter Fragen: Wie
ist das Verhältnis Sachsens zu einer Königsherrschaft zu bestimmen, die
selbst erst noch genauer zu definieren ist. Was heißt denn „Sachsen",
was bedeutet „ottonisches Reich"? Und damit nicht genug. Kann ein
Jahrhundert deutscher Geschichte, ein an Kriegen und Aufständen, ein an
bedeutenden Herrschergestalten reiches Jahrhundert geschildert werden,
ohne eine Vielzahl von Fakten zu referieren? Ich möchte es versuchen,
möchte aber unter dem Vielen, das ich übergehe, einen Sachverhalt
hervorheben: Die Frauen ottonischer Herrscher, Mathilde, Adelheid oder
Theophanu, treten in der Geschichte viel profilierter, ja sogar in ihrer
Persönlichkeit erkennbarer hervor als in späteren Zeiten. Das hat mit
unserem Thema insofern etwas zu tun, als diese Herrscherinnen nicht in
Sachsen geboren waren. Wenn es im Laufe unserer Darstellung
vorübergehend so erscheinen mag, als hätten die Sachsen in
selbstgewissem Stammesstolz verharrt, so ist daran zu erinnern, dass
diese politisch so einflussreichen Frauen selbst als Regentinnen von den
Sachsen akzeptiert wurden. So viel auch an Ereignissen im folgenden
unterdrückt werden wird, so ist doch die zentrale Frage zu behandeln,
was Sachsen in ottonischer Zeit eigentlich war.
1. Das frühmittelalterliche Sachsen als Land des
Überflusses?
Sachsen als Land des Überflusses. Sogar oft soll
diese Charakterisierung Kaiser Heinrich II. gebraucht haben, der letzte
der ottonischen Herrscher. Er war Herzog von Bayern gewesen, bevor er
1002 zum König gewählt wurde. Seine Äußerung überrascht. Denn blühendere
Landschaften als Sachsen hatte ein Herrscher gesehen, der zum Beispiel
in Mainz der alten Römerstadt gewählt wurde, in jener Stadt, von der
damals ein arabischer Reisender berichtete: Erstaunlich sei, was hier an
Gewürzen feilgehalten werde, an Gewürzen, die aus dem fernsten
Morgenlande stammen. Davon hatte man in Sachsen nichts gehört. Wenn
arabische Reisende etwas von diesem Raum zu rühmen wussten, dann war es
das Wasser des sogenannten Paderborner Metbrunnens. Nichts ansonsten
schien ihnen bemerkenswert.
Dieses Sachsen, von dem Heinrich II. gesprochen hatte, war
ein Raumbegriff, der noch nicht elbaufwärts gewandert war. Er schloss noch
Westfalen ein und reichte im Osten bis in das heutige Sachsen-Anhalt hinein. Die
Elbe war weitgehend Grenzstrom gegenüber den Slawen. Das heutige Niedersachsen
bildete den Kernraum des frühmittelalterlichen Stammesgebiets. Ein solches
Gebiet aber ist nicht von moderner Flächenstaatlichkeit her zu verstehen,
sondern von der Natur der Stämme als personaler Verbände gemeinsamen Rechts. Die
Wandelbarkeit der damit verbundenen personalen Konstellationen erweist sich etwa
darin, dass für Karl den Großen der Schwerpunkt Sachsens im Westen lag -
Stichworte mögen Lippspringe und Paderborn sein - , während hundert Jahre später
der Harzraum das politische Gravitationszentrum war, der Raum, in dem besonders
die Liudolfinger begütert waren, jenes Geschlecht, aus dem die Kaiser stammten,
die allgemein unter dem Namen Ottonen bekannt sind.
Für die Welt vor 1000 Jahren ist die Frage der Ernährung ein
Frage des Überlebens, die entscheidende Frage, wie sogar, genau gelesen, die
Worte des Kaisers besagen. „Überfluss" besagt nur, dass es genug zu essen gibt.
Und was heißt das konkret?
Die Untersuchung von Knochenfunden auf burgähnlichen Anlagen
hat erbracht, dass um das Jahr 1000 noch Bären gejagt wurden, dass der Ur und
der Elch im Sächsischen noch heimisch waren. Langsam erst hatte sich in jener
Zeit der stationäre Roggenanbau durchgesetzt, von einer Fruchtwechselwirtschaft,
von einer Dreifelderwirtschaft ist noch nichts bekannt.
Das ist kein Wunder. Einzelhöfe, Weiler,
Streusiedlungen bestimmen die Agrarlandschaft. Dörfer haben sich noch
nicht als genossenschaftliche Gemeindeverbände entwickelt. Immer noch
gilt das Gebot des Herren eines Fronhofes, des „maior", des Meiers für
die Höfe, die von diesem Fronhof abhängig sind. Streusiedlungen. Bis zu
30 km musste manch ein Bauer laufen, um sein Kind in der Pfarrkirche
taufen lassen zu können. Erst 200 Jahre später war das Pfarrnetz enger
geknüpft.
Einseitig war die Ernährung in diesen
Streusiedlungen, die genau genommen Siedlungskammern waren in einer
Umwelt der Urwälder, der ausgedehnten Moore, der versumpften Tal- und
Flußauen, kurzum in einer Umwelt, die jener Zeit als „terra inculta",
als unbebaubares Land, als „Unland" bedrohend und faszinierend zugleich
erschien. Standortgebunden, und das hieß: einseitig war die Ernährung in
diesen Siedlungskammern, abhängig von dem, was die unmittelbare
Gemarkung bot. Ein intensives Markt- und Handelsgeschehen erreichte
diese Siedlungskammern noch nicht.
Städte im Sachsenland? Das mag am ehesten noch für
die Bischofsstädte zutreffen, ansonsten ist das urbane Leben diesem
Stamm noch fremd. Der Wandel der Zeiten ist am besten am Verhältnis
zwischen Goslar und Werla zu verfolgen. Werla war die traditionelle
Versammlungsstätte der Ostsachsen, jedermann kannte sie um das Jahr
1000; kaum jemand aber kannte damals den Namen des nahegelegenen Goslar.
Dieses wurde erst im 11. Jahrhundert, vornehmlich durch die Förderung
der salischen Kaiser und dem Bau des Stiftes St. Simon und Juda zur
geheimen Hauptstadt des Reiches. Die Zeitgenossen waren so erstaunt über
diesen Wandel, dass sie behaupteten, noch um das Jahr 1000 wäre Goslar
eine einfache Jagdhütte gewesen. Der Aufstieg Goslars bedeutete den
Abstieg Werlas. Die berühmteste Pfalz der ottonischen Zeit, also das 10.
Jahrhunderts, wurde von den salischen Kaisern nicht mehr besucht.
Auf den ersten Blick gibt es wenig Anhaltspunkte dafür, dass
Heinrich II. ein realitätsnahes Lob formuliert haben könnte. Aber es gab damals
noch keine wissenschaftlichen Referenten, die ihm eine gediegene
Wirtschaftsanalyse hätten vorlegen können. Der Kaiser urteilt nach Maßgabe
dessen, was ihm und seinem Gefolge im Sachsenlande aufgetischt wurde; er gehörte
zwar dem ottonischen Hause an, aber als Herzog von Bayern war ihm Sachsen lange
fremd geblieben. Offenbar überraschten ihn, als er zum König gewählt worden war,
die Zustände in dem Stammland seines Hauses. Und diese Zustände nahm er in den
königlichen Pfalzen wahr; denn diese bilden im Sachsenland die wichtigsten
Aufenthaltsorte der Könige, sei es Werla, sei es Pöhlde am Harz, sei es Grone
bei Göttingen.
Eine Pfalz liegt in Tallage; sie ist keine Befestigung wie
eine abweisende, auf Bergeshöhe errichtete Burg, sie ist lediglich durch einen
Palisadenzaun bewehrt, umschließt ein System von Wirtschaftshöfen und
kennzeichnet insgesamt eine Herrschaft, die im Innern keine Feinde zu fürchten
braucht. Eine Pfalz ist ein wirtschaftliches Zentrum, organisiert zur Versorgung
des reisenden Hofes. Dieser reisende Hof sucht aber auch gerne die großen
Reichsstifte wie Gandersheim oder Quedlinburg auf, wo sich die Äbtissin seufzend
in ihre kostspieligen Gastgeberpflichten fügen musste.
Mit Andeutungen haben wir uns begnügen müssen, um zu
begründen, warum Heinrichs II. Feststellung nicht ganz aus der Luft
gegriffen war. Angesichts des reichen liudolfingischen Hausgutes war der
Tisch in den Pfalzen des sächsischen Landes für einen König immer gut
gedeckt. Und dazu kam noch etwas weiteres. Im 10. Jahrhundert hatte
sich, wohl kaum unabhängig vom ottonischen Königtum, auf
wirtschaftlichem Gebiete einiges getan.
An erster Stelle ist hier der Silberbergbau am Rammelsberg zu
nennen. Natürlich hat dieser Bergbau viel ältere Traditionen, und die schöne
Legende von der Erschließung der Erzadern zur Zeit Ottos des Großen ist eine
komprimierte Erzählung, die, wie üblich im Mittelalter, eine Art Zeitraffer und
keinen konkreten Ablauf darstellt. Aber unzweifelhaft ist, dass erstmals in
ottonischer Zeit der Silberreichtum des Harzes politisch weitreichendgenutzt
wird. Ausdruck dafür sind die sogenannten Otto-Adelheid-Pfennige, Münzen mit den
Bildern des Herrscherpaares, die seit dem ausgehenden 10. Jahrhundert
massenweise geprägt wurden, die sich in großer Zahl in den skandinavischen
Münzhorten wiederfinden lassen. Gewiss waren die Otto-Adelheid-Pfennige keine
Reichswährung gewesen; eine solche steht noch in sehr weiter Ferne, aber sie
waren monetärer Ausdruck einer wirtschaftlichen Entwicklung, waren deren äußeres
Zeichen. Wessen Münzen bis nach Skandinavien gebraucht werden, der treibt einen
weitgespannten Handel, von dem ansonsten wenig in quellenarmer Zeit bekannt ist.
Ebenso wortkarg sind die Quellen auch, was einen anderen
Reichtum sächsischen Landes ausmacht: der Reichtum an Salzquellen. Denn ohne
Salz, das ja vielfach auch ein Währungssurrogat sein konnte, ist menschliches
Leben gar nicht denkbar, ganz abgesehen davon, dass auch das Vieh seinen
Salzbedarf hat. Hier ist nicht nur an die Lüneburger Saline zu denken, die sich
im Verlauf des Mittelalters zum größten Industriebetrieb Nordeuropas
entwickelte, hier ist auch an die zahlreicheren kleineren Salinen zu erinnern,
die zumindest im regionalen Umkreis den Bedarf deckten. So gehörte Gitter mit
seinen Salzquellen zum Pfalzkomplex Werlas.
Eines aber hatte Sachsen damals noch nicht in größerer Zahl
zu bieten: Kostbarkeiten, die sich in beeindruckenden Kirchenschätzen, in
aufwendig und kunstvoll gearbeitetem liturgischem Gerät ausdrückten. In dieser
Hinsicht muss zu Anfang des 10. Jahrhunderts das Sachsenland arm im Vergleich zu
den oberdeutschen Landschaften gewesen sein. Bei ihren in ganz Europa
gefürchteten Raubzügen ließen die Ungarn Sachsen beiseite. Sie plünderten
Klöster in Oberitalien, im deutschen Süden und in Südfrankreich. In Sachsen, so
wussten sie, war nichts zu holen. Im Jahre 926 jedoch sah für sie die Welt
anders aus; sie fielen nach Sachsen ein. Dieser Einfall aber hatte wenig mit
Raub und Plünderung, viel aber mit einem politischen Test zu tun.
Die Ungarn stellten die Frage, was für eine Herrschaft der
919 in Fritzlar zum König gewählte Ottone Heinrich I. ausübte, wie festgefügt
das neue Königtum war. Damit sehen wir uns gezwungen, den zunächst so deutlich
sich abzeichnenden roten Faden, Sachsen als Küche des Reichs, fallen zu lassen
und nach diesem Reich zu fragen.
2. Königtum und Reich der Ottonen
Herrschaft der Ottonen: Als im 15. Jahrhundert Humanisten
sich um eine Konzeption deutscher Geschichte bemühten, entdeckten sie die damals
in Vergessenheit geratenen Ottonen wieder: Sie erkannten, dass mit der
Kaiserkrönung Ottos des Großen 962 eine Schicksalsfrage deutscher Lande
aufgeworfen und zugleich eine geschichtliche Kontinuität begründet worden war;
sie erkannten die Bedeutung der ottonischen Herrschaft, die im damaligen Europa
ihresgleichen suchte. Wie konnte sich aber diese Herrschaft entwickeln, die im
Sachsenlande begründet war, in einem Land, in dessen Sümpfen und Wäldern am
Drömling sich 938 selbst ein kriegserfahrenes ungarisches Heer verirrte?
Das Reich Karls des Großen war untergegangen, als um
die Jahreswende 918/19 Sachsen und ein Teil des fränkischen Hochadels
einen neuen König wählten, eben Heinrich I., den ersten Herrscher aus
ottonischem Hause. Schon der Name dieses Herrschers, damals in Sachsen
ebenso ungewöhnlich wie in deutschen Landen, der Name eines Herrschers,
der ihm von seinem Großvater mütterlicherseits gegeben worden war, weist
auf Veränderungen der Zeiten. Die Karolinger hießen normalerweise Karl
oder Ludwig. Der Name Heinrich sollte aber dann der verbreitetste
Königsname der europäischen Geschichte werden.
Mit diesem Hinweis ist am einfachsten zu begründen, was
Kaisertum in ottonischer Zeit bedeutete; es enthielt noch nicht einmal
ansatzweise ein imperiales Programm, aber es verbürgte europaweites Ansehen. Das
drückte sich in Heiratsverbindungen aus, aufgrund derer Namen weitergegeben
wurden.
Heinrich I. war der erste König, der diesen
verbreitetsten Namen der europäischen Herrschergeschichte trug. Es war
aber alles andere als eine machtvolle Herrschaft, die er antrat. Völlig
verfehlt ist das Konstrukt früherer Forschung von einem machtvollen
Herrscher, der mit eiserner Hand das Reich einte usw., jenes Konstrukt,
das dann die Heinrich I.-Verehrung durch Heinrich Himmler entstehen
ließ. Gestatten Sie mir bitte, kurz das Thema zu verlassen und an ein
mutiges Zeichen von Gelehrsamkeit in den schlimmen zwölf Jahren zu
erinnern.
Ein Jahr nach der angeblichen Auffindung der Gebeine
Heinrichs I., was von Heinrich Himmler pompös in Szene gesetzt worden
war, veröffentlichte ein junger Gelehrter, Carl Erdmann, in der
angesehensten Zeitschrift der deutschen Mediävistik einen Aufsatz, der
diese „Auffindung" als grobe Fälschung entlarvte.
Die Quellen zeigen folgendes Bild von Heinrich I.: Er
versuchte seine Herrschaft durch Bündnisse, durch das Prinzip der, wie
es in den Quellen heißt, „amicitia", der Freundschaft, zu stärken. Ein
gewissermaßen kooperativer Führungsstil schwebte ihm vor und steht auch
hinter seinen Worten: Es genügt mir, dass ich vor meinen Vorfahren den
Namen des Königs voraus habe. Diese Herrschaft also wollten die Ungarn
im Jahre 926 auf ihre Festigkeit prüfen. Ebenso wenig wie ansonsten in
Europa stießen sie auf Feinde, die ihnen gewachsen waren. Dabei muss
daran erinnert werden, dass die Ungarn kein wildes, zügelloses
Reitervolk waren, sondern eine Heeresorganisation besaßen, die an
Disziplinierung und taktischer Schulung der Reiterei in ganz Europa weit
überlegen war, Scheinangriffe ebenso wie scheinbare Fluchtbewegungen,
die dann in einer plötzlichen Kehrtwendung zu einem unerwarteten Angriff
führten, zu inszenieren vermochte. Siegreich drangen sie zunächst in
Sachsen ein. Es blieb Heinrich I. nur, betend in der Pfalz Werla die
Hilfe Gottes zu erflehen. Und es kam zur überraschenden Wendung des
Kriegsglücks. Den Sachsen gelang es, einen der Führer der Ungarn
gefangen zu nehmen. Um ihn zu befreien, willigten die Ungarn in einen
sechsjährigen Frieden, verlangten allerdings erhebliche Tribute. Diese
Wendung veränderte die Stellung des Königs in deutschen Landen. Erst mit
dem Jahre 926 nehmen süddeutsche Chronisten von der Herrschaft Heinrichs
I. überhaupt Notiz.
Zu übergehen ist die weitere Geschichte, die Frage
stellt sich, ob wir mit dieser Schilderung der Anfänge ottonischer
Herrschaft nicht geradewegs eine Forschungsauffassung bestätigen, die
der Herr Präsident einleitend angesprochen hat, jene Auffassung, wonach
das Reich der Deutschen erst Ende des 11. Jahrhunderts entstanden sei,
als sich der Name Regnum Teutonicum, Reich der Deutschen - übrigens nur
vorübergehend - verbreitet. Unzweifelhaft: Bis tief ins elfte
Jahrhundert hinein wird nur von einem Regnum, von einem Reich ohne jeden
weiteren Zusatz gesprochen. Der König heißt „rex", nach der
Kaiserkrönung natürlich Imperator, beides ohne jeden weiteren Zusatz.
Von Deutschland oder von deutsch ist nicht die Rede.
Zu erinnern ist ein tiefes Wort Lichtenbergs: Es
mache einen großen Unterschied aus, immer noch zu glauben oder wieder zu
glauben. Immer noch zu glauben, dass Heinrich I. das deutsche Reich mit
eiserner Hand begründet habe, ist Unfug. Aber wieder zu glauben, dass
dieses Reich in ottonischer Zeit entstanden war, eine Leistung des
Herrschergeschlechtes ebenso war, wie die der Stämme, wobei an erster
Stelle der Sachsen zu gedenken ist, kann - frei nach Lichtenberg - von
Einsicht zeugen. Zu den bekanntesten Quellen des deutschen Mittelalters
gehört der Bericht über die Königswahl Ottos I. 936, ein Bericht, der
den zeremoniellen Abschluss der Königserhebung mit dem Dienst der
Herzöge der deutschen Stämme für den neu gewählten König einlässlich
schildert.
Als Kämmerer, Truchseß, Marschall und Schenk wird der neue
König von den Repräsentanten der Stämme beim abschließenden Königsmahl bedient.
Ausdruck eines Gemeinschaftsbewusstseins. Dieses zeichnet sich in jener Zeit
unter anderem auch darin ab, dass nach Ausweis des Namenbestandes - viele
Hochadelige heißen Gunther oder Siegfried - das Nibelungenlied zum gemeinsamen
Erzählstoff in deutschen Landen gehört.
Eine auf den ersten Blick eher unscheinbare Urkunde
Ottos I., die erste Urkunde überhaupt, die von ihm überliefert ist,
erweist, wie der Herrscher selbst über sein Königtum dachte. Im Jahre
936 urkundet er über die Schutzherrschaft des Klosters Quedlinburg. Das
Kloster war eine ottonische Gründung. Der Schutz stand nach
herkömmlicher Auffassung den Nachfahren des Klostergründers zu,
Eigenkirchenrecht. Aber Otto I. denkt in bemerkenswerter Weise über
dynastische Interessen hinaus. Er bestimmt, wenn ein anderer als jemand
aus seinem Hause zum König gewählt würde, dann soll dieser König die
Schutzherrschaft über das Kloster wahrnehmen. Das familiengebundene
Eigenkirchenrecht ist hier zugunsten eines neu definierten Königsrechts
aufgegeben worden. Und das heißt doch: Das Königtum ist eine eigene
Größe, ist eine Institution, die mit den stammesgebundenen
Familienverbänden nichts mehr zu tun hat.
Im Kern ist hier der Gedanke verborgen, dass es statt
personaler Herrschaft um transpersonale Institutionen, also um ein Reich
geht. 1025 sollte diesem Gedanken der erste Salier auf dem Königsthron,
Konrad II., gegenüber den Bürgern von Pavia klaren Ausdruck geben: Wenn
der König sterbe, bleibe doch das Reich bestehen.
Zur Transpersonalität, zum institutionellen
Reichsbegriff gehört ein zentraler Gedanke: Dieses Reich ist nicht mehr
teilbar, es ist eine unteilbare, eine überzeitliche Größe. Anfänge des
europäischen Staatsgedankens. Zur Verdeutlichung: Die Nachfolger Karls
des Großen hatten ihre Herrschaft immer wieder geteilt. Das neue Regnum
aber war, auch wenn es noch keinen klärenden Namen in Gestalt eines
Adjektivs deutsch trug, ein unteilbares Reich. Alle Autoren, die sein
Entstehen in das späte 11. Jahrhundert verlegen, übersehen einen
schlichten Sachverhalt. Damals hatte gerade die heftige
Auseinandersetzung zwischen Sachsen und dem salischen Königtum getobt,
eine Auseinandersetzung, die an Schärfe und Wahrnehmung des
Widerstandsrechtes und nicht zuletzt an seiner langen, eine Generation
währenden Dauer nichts Vergleichbares in der damaligen europäischen
Geschichte kannte. Aber selbst während dieser heftigen
Auseinandersetzung war niemals von den Sachsen der Gedanke erwogen
worden, sich vom Reich zu lösen. So sehr die Wahrung der Rechte ihres
Stammes ihnen angelegen war, so häufig der Begriff „patria", Vaterland,
in ihrer Argumentation auftauchte: An eine Trennung vom Reich dachten
sie zu keiner Zeit. Dieses Reich war ihnen inzwischen eine
selbstverständliche Größe geworden. Erbe, wie wir feststellen, der
ottonischen Zeit.
Auf eine Abfolge von Geschichtsdaten hatten wir,
selbst den großen Sieg über die Ungarn 955 auf dem Lechfeld übergehend,
verzichtet, um das Wesentliche herauszuarbeiten, den tiefen Wandel, der
im Reichsbegriff der ottonischen Zeit gegenüber der karolingischen
Tradition liegt. Und dieser Wandel war nicht nur von einem
Herrscherhaus, sondern auch von einem Stamm getragen, der für die
Karolinger noch am Rande Europas lag. Nur ein Beispiel: Als nach 835
Erzbischof Ebo von Reims politisch untragbar geworden war, wurde er als
einfacher Bischof nach Hildesheim versetzt, oder eigentlich verbannt.
Sachsen das karolingische Sibirien und hundert Jahre später die Küche
des Reiches?
3. Die Küche des Reiches
Zu Zeiten des erwähnten großen Kampfes zwischen Sachsen und
dem salischen Königtum schrieb am fernen Bodensee ein Mönch, der Chronist des
Klosters Petershausen, dass Sachsen die Küche des Reiches sei.
Zwischen dem Sachsenlob Heinrichs II. und der Behauptung des
Mönches aus Petershausen scheint auf den ersten Blick kein großer Unterschied zu
bestehen, bezeichnen doch beide Zitate gemeinsam, dass Sachsen die ökonomische
Basis des ottonischen Königtums gebildet hatte. Die Äußerung des Petershauser
Mönches aber hat einen Widerhaken. Was heißt denn Küche in der damaligen Zeit?
Zunächst einmal: Die Küche ist das ganze Mittelalter hindurch ein äußerst
ungemütlicher Arbeitsplatz. Im 10. Jahrhundert hatte sie angesichts der damals
vorherrschenden Wirtschaftsverfassung, der sogenannten Fronhofsorganisation,
eine besondere Bedeutung: Sie stellte, an einem Haupthof in Herrschaftsnähe
angesiedelt, zugleich die Versorgung auch der Menschen, die in den
Sonderkulturen der Nebenhöfe arbeiteten, sicher. Küche meint also unter den
damaligen wirtschaftlichen Bedingungen: Zwang zur Gemeinschaftsverpflegung und
damit Dienst. Und genau das benannte der Mönch von Petershausen: Die Sachsen
sollten dem Reich dienen, sie sollten mit ihrer Leistungsfähigkeit ihm zur
Verfügung stehen. Verwickelte Zusammenhänge stehen hinter dieser scheinbar
klaren Äußerung. Dienst auf der einen, Herrschaftsnähe auf der anderen Seite.
Wir lösen diese schwierigen Zusammenhänge mit einem einfachen Hinweis: Zur Küche
gehörten auch die Brotkneterin und der Brotkneter, Leute, die sich - im
Mittelalter äußerst schwierig - die Hände haben waschen müssen. Sicherlich
Diener, auf der anderen Seite aber auch Diener in Herrschaftsnähe. Die englische
Sprache bewahrt die Probleme. Aus der „hloefdige" der Brotkneterin und der
entsprechenden Bezeichnung für den Brotkneter entwickeln sich Lady und Lord, aus
der Bezeichnung für einen Diener also ein Adelstitel.
Der Mönch in Petershausen formulierte knapp das
Programm Heinrichs IV. Aber damit scheiterte der Salier völlig - und das
war in ottonischer Zeit angelegt. Denn schon damals begnügten sich die
Sachsen nicht damit, dass einer ihrer Herren zugleich König des Reiches
war, sie dachten auch unter einem ottonischen König zunächst einmal an
die Rechte und die Würde ihres Stammes.
4. Widukind von Corvey und das sächsische
Stammesbewusstsein
Scheinbar verliere ich endgültig den roten Faden
meiner Darstellung, wenn ich Ihnen den bedeutendsten Geschichtsschreiber
des 10. Jahrhunderts darstelle; und selbst wer mit mir die Einschätzung
teilt, dass Kultur - was heute bisweilen in Zweifel gezogen wird - ein
Teil des Wohlstandes ist, kann mir vorwerfen, dass ich die kulturelle
Entwicklung Sachsens im 10. Jahrhundert doch viel besser an den
Kanonissenstiften darstellen sollte. Denn vor allem diese Stifte, die
sich von Nonnenklöstern dadurch unterscheiden, dass sie den
Konventualinnen größere Freiheitsräume gestatten, hatte der sächsische
Hochadel im 10. Jahrhundert gegründet. Mit dem Namen Hrotsvit von
Gandersheim, der - wie der deutsche Erzhumanist Konrad Celtis sie nannte
- ersten deutschen Dichterin, verbindet sich die Erinnerung an eine
kulturelle Blüte, singulär im damaligen Europa. Wenn ich Widukind von
Corvey in den Mittelpunkt stelle, so deshalb, weil er der beredetste
Zeuge für ein sächsisches Stammesbewusstsein unabhängig von der
Königsherrschaft ist, weil er bezeugt, dass so monolithisch, wie in der
älteren Forschung dargestellt, die ottonische Herrschaft gar nicht
gewesen sein konnte, dass sie sich nicht nur mit divergierenden
politischen, sondern auch mit divergierenden Stammesinteressen
auseinander zu setzen hatte.
Von Selbstbewusstsein zeugt der Beginn von Widukinds Chronik.
Er habe genug Heiligengeschichten abgeschrieben. Nun wolle er sich der
Geschichte seines Hauses und seines Stammes zuwenden. Seines Hauses: Der Name
Widukind zeigt, dass inzwischen der Repräsentant sächsischen Widerstandes gegen
die Herrschaft Karls des Großen im Namengut des Hochadels, hier des
immendingischen Familienverbandes in ehrender Erinnerung weiterlebt; Stamm - das
ist für Widukind eine Größe, die zwar auch das ottonische Haus einschließt, die
aber auch außerhalb des ottonischen Hauses einen einheitlichen Rechtsverband
bildet. Der selbstbewusste Auftakt seiner Chronik muss unter realgeschichtlichen
Bedingungen gewürdigt werden.
Denn es ist nicht so, dass im 10. Jahrhundert ein Mönch
schreiben konnte, was er wollte; dazu war das Pergament, aus Kuh- oder
Schafshaut gewonnen, viel zu teuer.
Man muss sich die Mühe vorstellen, die es machte, überhaupt
Beschreibstoffe herzustellen, die Mühen, die das Enthaaren der Häute ebenso
einschloss wie das Abreiben und Glätten mit dem Bimsstein, das mühsame
Punktieren der Schreiblinien und nicht zuletzt die problematische Herstellung
der Tinte, um zu ermessen: Das Beschreiben eines solch kostbaren Stoffes musste
im Kloster gebilligt worden sein, Schreiben ist also konsensgebunden. In der
Abtei Corvey, deren Mönche sächsische Adelssöhne waren, bestanden offenbar keine
Bedenken, dass der Mitbruder Widukind sich nicht nur frommem Gebet und der
Herstellung liturgisch wichtiger Handschriften hingab, sondern die Geschichte
seines Stammes schrieb und dabei viel Pergament verbrauchte. Gewiss, für
flüchtige Notizen hatte man die Wachstäfelchen, aber auf diesen handlichen
Täfelchen war noch nicht einmal eine einzelne historische Begebenheit
darzustellen. Ich würde wirklich den Faden verlieren, wenn ich Ihnen die
spannenden Geschichte erzählen würde, die Widukind überliefert, Geschichten, die
ihn als einen, wie man gesagt hat, „Spielmann im Mönchsgewand" erscheinen
lassen. Wichtig erscheint mir hingegen, zu untersuchen, wo dieser Chronist die
Fakten umbiegt, aus welchen Gründen er dies tut, und wo er wichtige Sachverhalte
einfach unterschlägt; gerade in diesen Fällen zeigt sich Grundsätzliches:
Ottonische Herrschaft und sächsischer Stamm hatten keine deckungsgleichen
Interessen.
Der viel zitierte Bericht über die Königswahl Ottos
I. stammt in seiner anschaulichen und detailgenauen Darstellung
natürlich der Feder Widukinds. Der Mönch aber leitet seinen Bericht mit
einer waghalsigen Deutung ein, warum die Krönung Ottos in Aachen
stattfand, und zwar deshalb, weil Aachen in der Nähe von Jülich läge und
Jülich hätte den Namen von Julius Caesar. Daran hat natürlich niemand
bei der Inszenierung der Wahl von 936 gedacht; man wählte Aachen als die
karolingische Traditionsstätte und stellte sich damit in eine
karolingische Tradition. Aber genau davon wollte Widukind nichts wissen.
Wenn schon eine Tradition, dann die der Antike. Also nicht Karl der
Große, sondern Julius Caesar. Dahinter verbirgt sich Stammesbewusstsein.
Das Reich des Königs aus sächsischem Hause steht nicht in der Nachfolge
der Karolinger. Es ist eine Neuschöpfung, welche die von Widukind so
bewunderte Antike wieder aufleben lassen soll. Das war mitnichten nur
gelehrt versponnen, das war ein Widerspruch gegen das Bemühen des
Herrscherhauses, an die karolingischen Traditionen, etwa in der
Pfalzenorganisation, anzuknüpfen.
Widerspruch gegen die Politik des Herrscherhauses. Wenn
heutzutage überhaupt noch etwas von der Leistung Ottos des Großen allgemeiner
bekannt ist, dann die Gründung Magdeburgs, des als Missionserzbistum in den
Osten hineinwirkenden Erzbistums und die Kaiserkrönung in Rom 962. Über beide
Sachverhalte schweigt Widukind beharrlich. Und das ist kein Versehen, das ist
ein beredtes Schweigen. Die Gründung Magdeburgs sah man im traditionsreichen
Kloster Corvey mit großer Distanz, vielleicht sogar mit Unmut. Dabei ging es
nicht um die politischen Konzeptionen der sogenannten Ostmission, die in
Wahrheit ein brutaler Überherrschaftungsvorgang war, sondern um den neuen, den
fremden Heiligen, unter dessen Patrozinium, den himmlischen Schutz das Erzbistum
stehen sollte, den hl. Mauritius. Der Heilige des Sachsenlandes war seit alters
her der Patron des Klosters Corvey, der hl. Vitus, jener Heilige, der die
Ausstrahlung Corveys begleiten sollte vom hl. Veit zu Staffelstein bis hin zum
Prager Veitsdom. Deswegen verschweigt Widukind die Gründung Magdeburgs und
erwähnt statt dessen, dass Otto I. von schwerer Krankheit erst genas, als er den
hl. Vitus anflehte. Nicht der fremde, sondern der bewährte Heilige, der des
Klosters Corvey, hatte geholfen.
Noch handgreiflicher in seiner Opposition gegen die
Politik Ottos I. ist Widukinds Verschweigen der Kaiserkrönung, jenes
Ereignisses, das Hrotsvit ihren Mitschwestern in Gandersheim als Folge
einer romantischen, von abenteuerlichen Zufällen begleiteten
Liebesgeschichte geschildert hatte. Was die Konventualinnen in
Gandersheim faszinierte, übergeht Widukind wortlos. Dabei aber hat er
ein Problem.
Otto I. heißt inzwischen „Imperator". Das erklärt der
Chronist ganz anders als mit der römischen Krönung. Er lässt nach dem Sieg auf
dem Lechfeld 955 das Heer den Herrscher zum Kaiser ausrufen. Eine Reminiszenz
gelehrter Art an das antike Heerkaisertum gewiss. Er erklärt damit, dass Otto
Kaiser geworden ist, aber Kaiser, der als solcher von allen deutschen Stämmen
ausgerufen wurde, nicht Kaiser, der im fernen Rom gekrönt wurde. Das läuft
keineswegs auf den abgestandenen Gedanken eines romfreien Kaisertums hinaus, den
die ältere Forschung erfunden hatte. Widukind geht es um etwas ganz anderes. Wir
merken das an versteckter Stelle, als er einmal Livius zitiert und dessen
Bemerkung zustimmend übernimmt, wonach das römische Reich an seiner Größe zu
leiden begann. Das artikuliert die aktuelle Sorge des Corveyer Mönchs. Indem er
Livius zustimmend zitiert, erinnert er nicht an antike Geschichte, sondern
kommentiert politische Probleme seiner Zeit.
Tatsächlich gehört Widukind in die lange Reihe derer,
die erkannt haben, dass das, was an räumlicher Ausweitung gewonnen wird,
an institutioneller Tiefe verloren geht. Und in diesem Zusammenhang ist
daran zu erinnern, wer nach Widukind im Jahre 955 den Imperator ausruft:
das aus allen Stämmen zusammengesetzte siegreiche Heer.
Gemeinschaftsbewusstsein über Stammesgrenzen hinaus.
Widukind steht nicht allein mit seiner Opposition
gegen die ottonische Kaiserpolitik, mit einer Opposition, die er zwar
nicht artikulieren, aber durch dröhnendes Schweigen über die
Kaiserkrönung kenntlich machen kann. Opposition: Ein spektakulärer Fall.
Hermann Billung lässt sich 972 während des zweiten Romzuges Ottos I. vom
Erzbischof von Magdeburg feierlich, fast wie ein König nach Magdeburg
geleiten und legt sich - welch ein Skandal! - sogar in das Bett des
Königs. Zeremonieller Ausdruck oppositioneller Haltung, die offenbar von
vielen sächsischen Adeligen geteilt wurde. Der Kaiser straft, und er
straft hart. Der Erzbischof muss so viele Panzerreiter auf seine Kosten
nach Italien schicken, wie er Kerzen in den Kronleuchtern der Domkirche
zu Ehren Hermann Billungs angezündet hatte. Eine solche Strafe spüren
die Domherren bei ihren Mahlzeiten. Denn es ist überaus kostspielig,
einen solchen Panzerreiter auszurüsten, und das geht auf Kosten der
Versorgung der Domgeistlichkeit.
Unterhalb des ottonischen Kaisertums lebte also ein
sächsisches Selbstbewusstsein, ein Selbstbewusstsein, das aber nicht mit
Partikularismus verwechselt werden kann. Denn das Reich war für Widukind
ebenso wie für seine sächsischen Mitbrüder eine nicht zuletzt auf die
Kirchenorganisation begründete Größe. Unklar musste noch lange bleiben,
in welchem Verhältnis Herrscher des Reiches und Stamm zueinander
standen. Wer Sachsen als Küche des Reiches bezeichnet, geht von einem
Abhängigkeits-, ja sogar einem Untertänigkeitsverhältnis aus. Das war
natürlich nicht die Sicht der Sachsen; sie bemühten sich aber um Regeln,
um die Anfänge von Verfassung. Das erwies sich in einem scheinbar
marginalen Vorgang, der gleichwohl den Anfang einer grundlegenden
Verfassungsentwicklung Europas bezeichnet. Hochgestochene Worte? Wir
werden sehen.
5. Die Sachsen und die Königswahl Heinrichs II.
Im Jahre 1002 wurde der letzte Herrscher aus
ottonischem Hause, Heinrich II., der später als Gründer des Bistums
Bamberg heilig gesprochen wurde, nahezu handstreichartig in Mainz
gewählt. An dieser Wahl hatten die Sachsen nicht teilgenommen. Das ist
um so erstaunlicher, als gerade sie die Kandidatenfrage in den Monaten
zuvor wohl am intensivsten, harte Kontroversen nicht scheuend erwogen
hatten. Musste es unbedingt ein Angehöriger des ottonischen Geschlechts
sein, oder war das Reich nicht tatsächlich trotz der Sohnesfolge dreier
Ottonen ein Wahlreich? Heinrich II. reiste nach Sachsen, um den Stamm
für sich zu gewinnen. Das gelang, und auch eine zeremonielle
Schwierigkeit wurde gemeistert. Heinrich war bereits zum König gekrönt
worden, bevor die Sachsen ihn anerkannten.
Wie nun in einer Welt, in der dem Zeremonialhandeln
zentrale Bedeutung zukam, den Sachverhalt verdeutlichen, dass nunmehr
die Sachsen Heinrich II. anerkannt hatten? Die Lösung: In einer neu
erfundenen, gleichwohl feierlichen Zeremonie wurde die Gattin des
Königs, Kunigunde, in Paderborn gekrönt.
Soweit der äußere Ablauf der Ereignisse, in dem eine
ganz zentrale Handlung verborgen ist. Erst als Heinrich II. den Sachsen
versprochen hatte, all ihre Rechte zu wahren, überreichte ihm Herzog
Bernhard Billung als Zeichen der Anerkennung zum König das Reichssymbol
der heiligen Lanze. Zentral ist dabei nicht das Reichssymbol, zentral
ist der Vorgang, ein Sicherheitsversprechen des neuen Königs und die
sich daran anschließende Anerkennung durch den sächsischen Stamm. Das
erste Mal in der europäischen Verfassungsgeschichte liegt hier der Kern
eines Herrschaftsvertrages vor, einer Vertragsform, wie sie vielleicht
am bekanntesten in der englischen Magna Carta von 1215 ist und wie sie
grundlegend wurde für das Verfassungsdenken und die moderne
Staatlichkeit.
Küche des Reiches war, wie wir gesehen hatten, eher
abschätzig gemeint gewesen. Aber der Begriff führte dazu aus sächsischer
Perspektive den Hintergrund ottonischer Herrschaftsgeschichte
aufzuhellen. Mit der Entstehung des Reiches, das später heiliges Reich
und um 1500 heiliges römisches Reich deutscher Nation war, war von
Anfang an der föderale Gedanke verbunden gewesen.
Zu erinnern ist nicht nur an die Politik Heinrichs
I., in deren Mittelpunkt die Freundschaftsverbindungen standen, zu
erinnern ist auch an das Krönungsspiel des Jahres 936 mit seinem
zeremoniellen Herzogsdienst. Der sächsische Stamm artikulierte am
deutlichsten, worum es im Ursprung dessen ging, was späterhin zum
Föderalismus wurde: Wahrung der eigenen Selbständigkeit in Gestalt des
eigenen Rechts bei gleichzeitiger Verantwortung für das Ganze, für das
Reich. Nicht nur die Anfänge des deutschen Reiches, sondern auch die
seiner föderalen Struktur sind in ottonischer Zeit unter maßgebendem
Anteil Sachsens entwickelt worden. Anfang
|